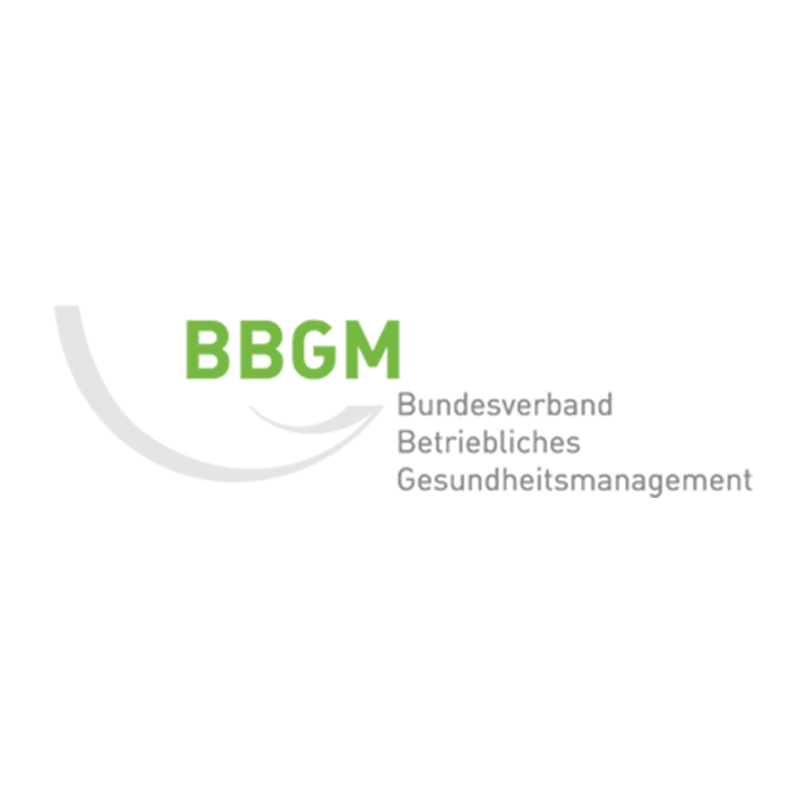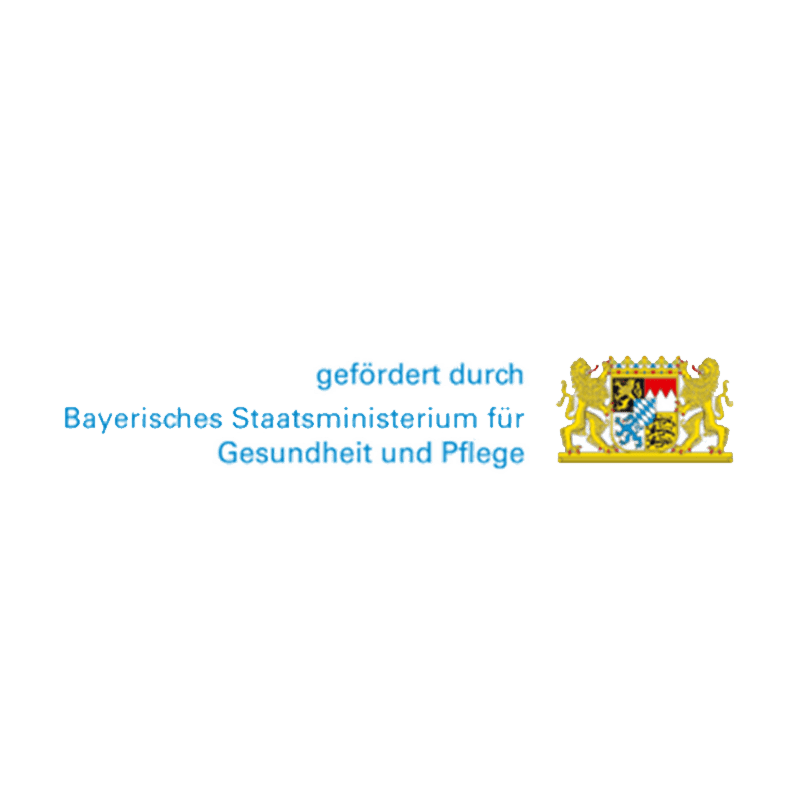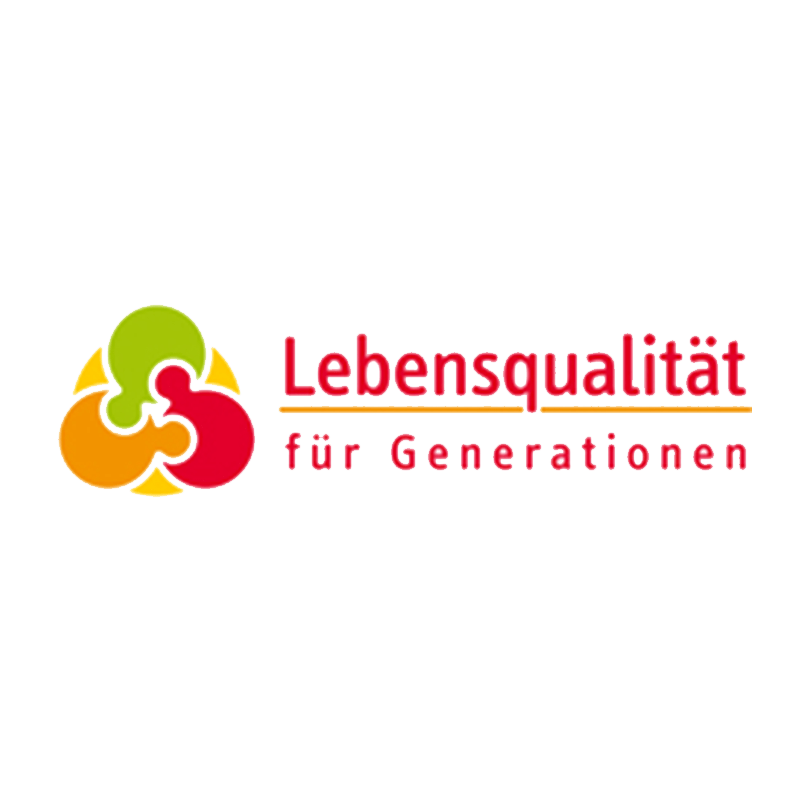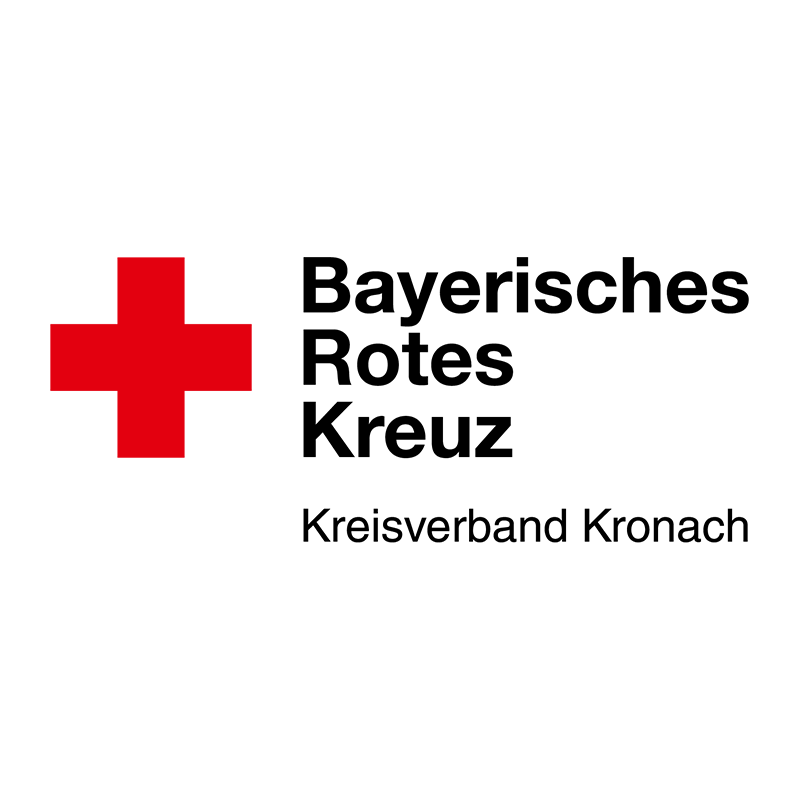Seit der Coronapandemie sind Videokonferenzen fester Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Zugleich ist der Ausdruck „Zoom Fatigue“ zum Synonym für die Erschöpfung geworden, die viele Beschäftigte nach (oder schon während) langen Online-Meeting-Tagen melden. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was hinter dem Phänomen steckt, welche Folgen es für Betriebe und das BGM hat und wie Sie als HR-, BGM-Verantwortliche oder Führungskraft praktisch gegensteuern können.
Was ist Zoom Fatigue? Definition und Entstehung
Zoom Fatigue beschreibt die spezifische Erschöpfung, die durch häufige Videokonferenzen entsteht. Der Begriff entstand während der Coronapandemie, als virtuelle Meetings zum Arbeitsalltag wurden und viele Beschäftigte über ungewöhnliche Müdigkeit und Konzentrationsprobleme klagten.
Ursachen von Zoom Fatigue
Eine zentrale Untersuchung dazu stammt vom Virtual Human Interaction Lab der Stanford University unter der Leitung von Jeremy Bailenson. Die Forschenden identifizierten vier Hauptursachen – zusammengefasst als nonverbale Überlastung:
- Intensiver Augenkontakt in Videocalls wirkt unnatürlich und stressfördernd.
- Selbstbeobachtung über die Kameravorschau steigert den Druck und senkt das Wohlbefinden.
- Bewegungseinschränkung durch ständige Kamera-Präsenz führt zu körperlicher Anspannung.
- Kognitive Überlastung entsteht durch erschwerte Interpretation nonverbaler Signale.
Auf dieser Basis wurde die Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF Scale) entwickelt – ein Messinstrument, das Zoom Fatigue in verschiedenen Dimensionen (visuell, sozial, emotional etc.) erfasst und seither in unterschiedlichen Organisationen Anwendung findet. Eine deutsche Orientierungsversion zum Download finden Sie hier.
Zoom Fatigue als Herausforderung fürs BGM
Für Unternehmen ist Zoom Fatigue mehr als ein Komfortproblem: Lang anhaltende digitale Erschöpfung beeinträchtigt Konzentration, kreatives Denken, Engagement und kann die Fehlzeiten, Unzufriedenheit und Fluktuation steigern. Zudem ist Zoom Fatigue eng mit Stressreaktionen und einer schlechteren Work-Life-Balance verbunden – Aspekte, die in das betriebliche Gesundheitsmanagement fallen. HR und Führungskräfte sind deshalb zentrale Hebel: Sie beeinflussen Meetingkultur, Rahmenbedingungen und die Unterstützung von Mitarbeitenden (z. B. Ressourcen, Schulungen, Erreichbarkeitsregeln).
Warum Zoom Fatigue ein Thema für das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist
Betriebliches Gesundheitsmanagement adressiert systematisch sowohl körperliche als auch mentale Belastungen, bevor sie zu Erkrankungen werden. Zoom Fatigue lässt sich hier zuordnen, da sie
- eine präventiv angehbare Belastung ist (Meeting-Design, Pausen, Arbeitszeitgestaltung),
- sich auf kollektive Leistungsfähigkeit auswirkt und
- sich mit klassischen BGM-Bausteinen (Schulung, Arbeitsgestaltung, Präventionsangebote) wirksam bearbeiten lässt.
Statt nur einzelne Symptome zu lindern (z.B. Erschöpfung nach einem Marathon-Meeting) empfiehlt sich eine strategische Integration:
Analyse → Maßnahmenmix (technisch, organisatorisch, trainingsbasiert) → Monitoring
Studien & Forschungsergebnisse zur Zoom Fatigue
Wie eingangs erwähnt, gibt es für das Phänomen Zoom Fatigue bereits wissenschaftliche Grundlagen:
- Jeremy Bailenson aus der Stanford Studie lieferte eine frühe, einflussreiche Theorie: „nonverbal overload“ als Kernmechanismus (u.a. Close-Ups, permanente Blick-Rückmeldung, andauerndes Aufmerksamsein).
- Die Forschungsgruppe um Fauville et al. entwickelte die ZEF Scale – ein validiertes Messinstrument, das Zoom Fatigue als mehrdimensionales Phänomen erfasst und so Vergleiche, Evaluation von Maßnahmen und Populationserhebungen ermöglicht.
Die Forschung hebt hervor, dass Zoom Fatigue kein rein technisches, sondern ein psychologisch erklärbares Problem ist – relevant für Interventionen im Arbeitskontext.
Die ZEF Scale (Zoom Exhaustion & Fatigue Scale) im Überblick
Die ZEF Scale kann in der Praxis genutzt werden, um:
- den Ist-Zustand (Baseline) zu erfassen,
- Maßnahmen empirisch zu evaluieren (vor/nach Intervention),
- Risikogruppen (z. B. Mitarbeitende mit hoher Meeting-Dichte) zu identifizieren und
- langfristiges Monitoring im BGM-Dashboard zu etablieren.
Die ZEF Scale in deutscher Fassung steht Ihnen hier zum Download bereit.
Anzeichen und Symptome von Zoom Fatigue
Typische Hinweise, die HR/Führungskräfte ernst nehmen sollten sind:
- Häufige Erschöpfungs- oder Reizbarkeitssignale nach Videotagen,
- Abnehmende Aufmerksamkeit in Meetings, häufiges Abschalten der Kamera,
- Zunehmende Fehler oder Verzögerungen in Aufgaben, Verlust der Motivation,
- Berichte über Nacken-/Augenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen.
Solche Signale rechtfertigen eine Analyse der Meetingstruktur und individuelle Gespräche, ggf. mit Angebot therapeutischer oder präventiver Maßnahmen.
Maßnahmen und Prävention – So beugen Unternehmen Zoom Fatigue vor
Um Zoom Fatigue nachhaltig vorzubeugen, braucht es einen mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl die Arbeitsorganisation als auch das Verhalten der Mitarbeitenden berücksichtigt.
Unternehmen können auf drei Ebenen ansetzen:
Strukturell-organisatorisch:
- Meetings effizient gestalten (Agenda, Zeitrahmen, Kamera-Regeln).
- Pufferzeiten und Pausen verbindlich einplanen.
- Meeting-freie Zeitfenster („No-Meeting-Fridays“) einführen.
Verhaltensorientiert:
- Beschäftigte und Führungskräfte über Ursachen und Strategien gegen Zoom Fatigue informieren.
- Achtsamkeit und Selbstfürsorge fördern (z. B. Schulungen, E-Learnings, Kurztrainings).
Gesundheitsförderlich im Sinne des BGM:
- Bewegungspausen, Microbreaks und ergonomische Arbeitsplätze etablieren.
- Firmenfitness- und Entspannungsangebote integrieren.
- Belastungen regelmäßig erfassen (z.B. mithilfe der ZEF Scale) und Fortschritte evaluieren.
Entscheidend ist: Prävention muss Teil der Unternehmenskultur sein – nicht nur Reaktion auf akute Erschöpfung. Wenn Führungskräfte und Teams aktiv eingebunden werden, lassen sich digitale Belastungen deutlich reduzieren und gesunde Routinen langfristig verankern.
Meetingkultur überdenken
Konkrete Regeln, die sich bewährt haben:
- Meeting-Filter: Ist das Meeting nötig? Gibt es eine asynchrone Alternative (E-Mail, kollaboratives Dokument)?
- Agenda und Zeitlimite: Klare Ziele, feste Dauer (z. B. 25/50 statt vollen 30/60 Minuten) und Endzeiten.
- Kamera-Regelung: Kamera „on“ nur wenn sinnvoll; keine generelle Pflicht. Kamera-Nutzung bewusst und freiwillig vereinbaren.
- Pausen: Zwischen Meetings 10–15 Minuten Puffer, kurze Erholungsmöglichkeiten
- Alternative Formate: Steh- oder Geh-Meetings für kurze Austausch-Termine sowie Audio-Only-Calls, wenn visuelle Informationen nicht nötig sind.
Diese Maßnahmen adressieren direkt die Ursachen nonverbaler Überlastung und mangelnder Erholung.
Aktive Pausen & Bewegung
Bewegungspausen mindern visuelle und muskuläre Ermüdung. Praktische Bausteine:
- Microbreaks (2–5 Minuten) nach jedem Meeting: aufstehen, dehnen, bewusst atmen.
- Geführte Kurz-Sessions (z. B. 10-minütige Mobilisations-Videos) die HR oder BGM regelmäßig anbietet.
- Firmenfitness-Programme als Teil des Präventionsangebots.
Schulung von Führungskräften
Achtsamkeit fördert Resilienz und mentale Balance:
- Kurse zu Achtsamkeit (z. B. MBSR-Module) und Stressbewältigung,
- Kurze Meditationseinheiten vor oder nach längeren Videotagen,
- Atemübungen, achtsame Pausen oder Body-Scans (geführte Achtsamkeitsübungen, bei denen man den eigenen Körper systematisch wahrnimmt) im digitalen Arbeitsalltag.
Regelmäßige Praxis stärkt innere Ruhe und Distanz zu Stressauslösern – und unterstützt, auch in intensiven Online-Phasen konzentriert, ausgeglichen und präsent zu bleiben.
Digitale-Detox-Kultur etablieren
Auch eine bewusste Offline-Kultur schützt vor Dauerstress und fördert Erholung:
- Kommunikationsfenster: Zeitblöcke ohne interne Nachrichten (z. B. „No-Message“ zwischen 18–7 Uhr),
- Notification-Guidelines: Nur dringende Pushes, klare Regeln für Kanäle (E-Mail vs. Chat),
- Vorbildfunktion: Führungskräfte schalten abends Notifications aus.
Solche Maßnahmen reduzieren dauerhafte Erreichbarkeit und geben Mitarbeitenden Raum zur Erholung.
Fazit – Zoom Fatigue braucht aktive Prävention
Zoom Fatigue ist mehr als Müdigkeit. Es ist ein erklärbares, messbares Phänomen mit spürbaren Folgen für Konzentration, psychische Gesundheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Für das BGM heißt das: handeln statt kaschieren – mit klaren Meeting-Regeln, bewusster Pausengestaltung, Bewegungs- und Entlastungsangeboten sowie Schulungen für Führungskräfte zur gesunden digitalen Führung. Nur wenn virtuelle Arbeit bewusst gestaltet wird, bleibt sie langfristig gesund, produktiv und teamorientiert.